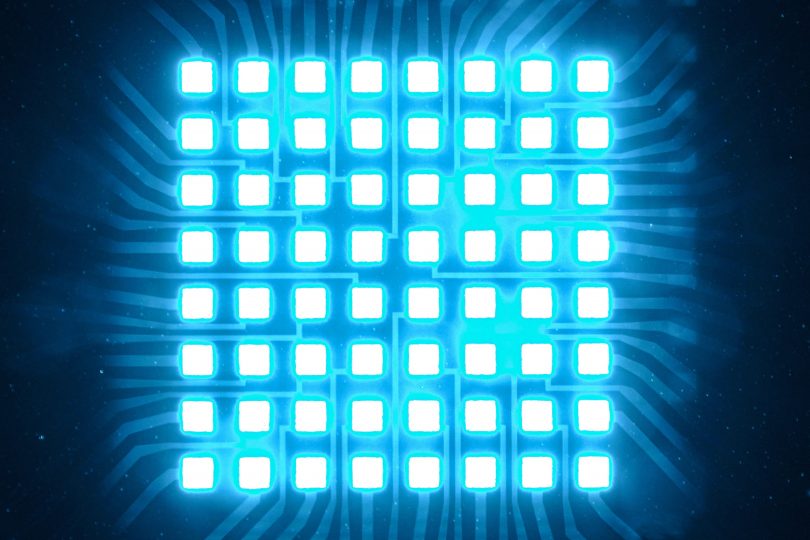Ein System auf einem Chip Professor Vadim Issakov ist neuer Professor für CMOS-Design
Seit dem 1. April 2021 ist Vadim Issakov Professor an der Technischen Universität Braunschweig. Damit übernimmt er die Leitung des Instituts für Elektronische Bauelemente und Schaltungstechnik, das nach dem neuen Schwerpunkt zum Institut für CMOS-Design umbenannt wird. Mit CMOS-Design wandeln Professor Vadim Issakov und sein entstehendes Team sperrige Apparaturen in handliche Chips um. Davon profitiert vor allem der TU-Forschungsschwerpunkt Metrologie, das Exzellenzcluster QuantumFrontiers und das Quantum Valley Lower Saxony. Aber auch Anwendungen in Radartechnik oder Medizin sind im Gange.

Professor Vadim Issakov leitet seit dem 1. April das Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungstechnik (künftig Institut für CMOS-Design). Bildnachweis: Max Fuhrmann/TU Braunschweig
Herr Professor Issakov, sind Sie gut an der Universität angekommen?
Sehr gut sogar – das war ein nahtloser Übergang. Schon vor dem 1. April zogen mich meine Aufgaben in die neue Stelle hinein. Beispielsweise beteiligte ich mich an zwei Projektskizzen zu „quantum-enabling technologies“, die wir Mitte April im Bundesministerium für Bildung und Forschung einreichten. Gleichzeitig stelle ich gerade neue Mitarbeitende ein und beschaffe neue Messtechnik für das Institut.
Im Fokus stehen aktuell zwei neue Großgeräte, die wir vor allem für Quantentechnologien benötigen. Etwa, um die Schaltungen zu analysieren, die wir für Quantencomputer bauen wollen. Besonders spektakulär ist hierbei die geplante Messstation zur Netzwerkanalyse. Dabei umfährt ein Roboterarm voller Sensorik einen Chip. Dabei nimmt der Roboter ein komplettes Strahlendiagramm auf. Hintergrund ist, dass wir in Zukunft sehr viele Antennen auf Chips haben werden. Der Messaufbau verformt das elektrische Feld und erschwert dadurch das Messen. Mit dem neuen Großgerät hätten wir ein roboterbasiertes System, das Chips aus jedem Winkel präzise scannen kann. So etwas gibt es bisher noch an keiner deutschen Universität.
Das Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungstechnik wird jetzt zum Institut für CMOS-Design. Was steht hinter diesem Namen?
„Complementary metal-oxide-semiconductor“, kurz CMOS. Diese bestimmte Form von Halbleiterbauelementen ist die Schlüsseltechnologie, um Komponenten wie Mikroprozessoren, Transceiver oder Radaranwendungen zu skalieren. Das heißt, ohne CMOS wären unsere Smartphones und Laptops größer, langsamer und teurer. Es gibt zwar auch andere Halbleiterbauelemente, die wir auch durchaus mit CMOS kombinieren, aber CMOS bietet insgesamt den höchsten Grad an Integration und Rekonfigurierbarkeit. Wir können damit also einerseits sehr viele Transistoren auf einem Chip realisieren und andererseits stets flexibel auf neue Anforderungen reagieren. Mit einem Institut für CMOS-Design richten wir uns daher fokussiert auf die Zukunft aus, ohne andere Halbleiterbauelemente aus den Augen zu verlieren.
Gleichzeitig hängen ganze Wirtschaftsbereiche von CMOS-basierten Halbleiterchips ab. Preis und Stückzahl von Chips hängen vor allem von den Technologieknoten, den verwendeten Materialien und vom Durchmesser der Wafer ab. Diese runden, etwa einen Millimeter dünnen Scheiben sind die Grundplatte für Chips. Je größer die Scheibe, desto mehr Chips kann man gleichzeitig herstellen. Bei CMOS messen die Wafer etwa 30 Zentimeter. Bei anderen Halbleiterbauelementen sind es nur 20 Zentimeter, oder noch weniger. Wer also hohe Stückzahlen braucht, etwa Chips für Mobiltelefone, hat bei CMOS einen Preisvorteil.

Professor Vadim Issakov mit einem Wafer, der Grundplatte für die Chip-Produktion. Bildnachweis: Max Fuhrmann/TU Braunschweig
Das klingt nach sehr vielen möglichen Anwendungen. Woran forschen Sie aktuell?
Im Institut möchte ich die Forschung auf drei Säulen stellen: Radar, Biomedizin und Quantentechnologien. Mit Radar-Anwendungen in CMOS beschäftige ich mich schon lange und intensiv. Beispiele sind etwa Systeme, die die Atmung von Erkrankten erfassen, ermüdete Personen am Steuer erkennen oder Abstände messen. In der Regel unterscheidet man zwischen Puls- und Dauerstrichradar sowie neuartigen digitalen Modulationsarten. Jedes Verfahren hat seine Vor- und Nachteile. So bietet beispielsweise der Pulsradar eine hohe Auflösung im Nahbereich, während der Dauerstrichradar besser entfernte Objekte erfasst. Ein Ziel von uns ist es, mit CMOS-Design unterschiedliche Modulationsarten auf einem Chip zusammenbringen. Ein einzelner Chip könnte dann je nach Szenario zwischen den Modulationen hin- und herschalten.
Die zweite Säule, CMOS-Anwendungen in der Biomedizin, bringe ich ebenfalls aus meinen bisherigen Forschungsaktivitäten mit. Ein Beispiel ist unsere Arbeit an einem unter der Haut tragbaren Chip, der unter anderem den Blutzucker misst. Unsere bisherigen Chips versorgt noch eine kleine Batterie. Aber nach spätestens neun Monaten haben diese keine Energie mehr und müssten ausgetauscht werden. Wir haben dagegen jetzt neue Chips im Sinn, die man kabellos aufladen kann. Das Prinzip kennt man vielleicht von Smartphones, die man auf eine Fläche legt und mit vollem Akku zurückbekommt.

Unterm Mikroskop zeigen sich die Strukturen, die am Institut mit CMOS-Design entstehen. Ein einzelner Chip kann dabei ganze Systeme unterbringen. Bildnachweis: Max Fuhrmann/TU Braunschweig
Mit solcher ubiquitären Sensorik füge ich mich zudem passgenau in den Forschungsschwerpunkt Metrologie der TU Braunschweig ein. Mit CMOS können wir einerseits sehr günstige Sensoren erstellen, die zugleich mit ihrer geringen Größe überall einsetzbar sind. Andererseits arbeite ich mit meinem Institut eng mit anderen Arbeitsgruppen zusammen. Beispielsweise gibt es sehr viele Schnittstellen zu der biomedizinischen Forschung von Professor Meinhard Schilling oder den Mikro-LED-Plattformen von Professor Andreas Waag. Auch versuche ich, bald Promovierende meines Instituts im Graduiertenkolleg Nanomet einzubinden.
Und die Säule zu Quantentechnologien?
Die dritte Säule, Quantentechnologien, entstand aus den vielen Anknüpfungspunkten mit den Forschenden im Exzellenzcluster QuantumFrontiers und dem Quantum Valley Lower Saxony. Beispielsweise arbeiten wir an möglichen Schaltungen für Quantencomputer. Aktuell sind Quantencomputer so riesig, dass sie ganze Räume füllen. Bei 50 Qubits mag das noch relativ unproblematisch in einem großen Labor umsetzbar sein. Für einen kommerziellen Quantencomputer wäre das jedoch extrem aufwendig und ohnehin kaum skalierungsfähig. Man stelle sich vor, wie groß so ein Quantencomputer bei 1000 Qubits sein müsste.
Im Quantum Valley Lower Saxony steuern wir die einzelnen Qubits, gefangene Ionen, mit Mikrowellen-Pulsen an. Auch da ist zurzeit noch der halbe Raum voll mit einzelnen Komponenten, die diesen Puls erzeugen. Auf einem Chip wäre das plötzlich sehr kompakt: statt einem halben Quadratmeter nur noch wenige Quadratmillimeter. Je mehr Funktionen des Quantencomputers wir so durch Chips ersetzen, desto kleiner und skalierbarer wird er.