Chemiker Prof. Stephan A. Sieber erhält Inhoffen-Medaille 2024 HZI und Technische Universität Braunschweig zeichnen Forscher aus
Für seine Forschung zu neuen Medikamenten gegen multiresistente Bakterien zeichnen der Förderverein des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig und die Technische Universität Braunschweig Prof. Stephan A. Sieber von der Technischen Universität München mit der Inhoffen-Medaille 2024 aus. Die Verleihung fand am 13. Juni 2024 im Haus der Wissenschaft in Braunschweig statt.

Laudator Prof. Dr. Thomas Carell (Leiter des Instituts für Chemische Epigenetik an der Ludwig-Maximilian-Universität München), Vorsitzender des Fördervereins des HZI Prof. Klemens Rottner, Inhoffen-Preisträger Prof. Stephan A. Sieber, TU-Präsidentin Prof. Angela Ittel und Prof. Thomas Pietschmann (Prokurist Wissenschaftliche Geschäftsführung des HZI). Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig
Nachdem im Kampf gegen multiresistente Bakterien viele Antibiotika in der Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt worden sind, stagniert die Anzahl der neuentwickelten Wirkstoffe. Die meisten der derzeit verwendeten Antibiotika sind auf wenige zelluläre Zielstrukturen konzentriert. Krankheitserregende Bakterien konnten deshalb vielfältige Resistenzstrategien entwickeln. Daher sind Bakterien-Stämme, die gegen gängige Antibiotika resistent sind, auf dem Vormarsch.
Wegen der großen Anzahl von essenziellen Proteinen in Bakterien besteht ein enormes Potenzial zur Entschlüsselung bisher unbekannter Zielstrukturen für Antibiotika, für die es noch keine Resistenzstrategien gibt. Darauf hat sich die Arbeitsgruppe um Stephan Sieber fokussiert. Unter Nutzung von Techniken der synthetischen Chemie, der funktionellen Proteomik, von Mikrobiologie und Proteinbiochemie und deren Kombination werden neue antibakterielle Zielstrukturen entdeckt. Auf der Basis dieser Erkenntnisse können Forschende neue Wirkstoffe identifizieren und durch chemische Veränderung optimieren.
Hans Herloff Inhoffen-Vorlesung: Mechanismen zur Selbstzerstörung von Bakterienzellen

Ausgezeichnet mit der Inhoffen-Medaille 2024: Chemiker Prof. Stephan A. Sieber von der Technischen Universität München. Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig
In der 29. Hans Herloff Inhoffen-Vorlesung am 13. Juni, in dessen Rahmen die Auszeichnung stattfand, widmete sich Prof. Stephan Sieber dem Thema, wie die bakterielle Resistenz mittels chemischer Moleküle überwunden werden kann. Die hierbei gewählte Strategie beruht darauf, der bakteriellen Zelle massiven Schaden durch die Deregulation von biochemischen Prozessen zuzufügen. Dabei suchen die Wissenschaftler*innen um Prof. Sieber nach Mechanismen, wie sich Bakterien selbst zerstören können. Hierfür haben sie ein Molekül entwickelt, das eine Peptidase, die für die Sekretion von Proteinen verantwortlich ist, überaktiviert. „Mit dieser Überaktivierung kommt die Zelle aber nicht klar. Es werden dadurch Autolysine in unkontrollierter Anzahl ausgeschleust, die im nächsten Schritt die Zelle zerstören. Das ist die Dysregulation. Oder wir induzieren Stress in Bakterien, aber schalten gleichzeitig die Stressantwort, die also den Stress zumindest etwas neutralisieren soll, aus. Das ist dann ebenfalls fatal“, sagt Prof. Sieber zusammenfassend.
Preisträger Prof. Sieber studierte Chemie an der Universität Marburg und fertigte seine Doktorarbeit 2004 in den Laboratorien von Prof. C. T. Walsh an der Harvard Medical School (USA) und Prof. M. Marahiel an der Universität Marburg an. Nach einem Postdoc-Aufenthalt 2006 am Scripps Research (USA) mit Prof. B. F. Cravatt begann er mit seinen unabhängigen Forschungsarbeiten an der Ludwig-Maximilian-Universität München, die durch das Emmy Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurden. 2009 erhielt er einen Ruf an die Technische Universität München als Inhaber des Lehrstuhls für Organische Chemie II. In den Jahren 2011, 2016 und 2023 erhielt er einen ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant sowie einen ERC Advanced Grant.
Über den Preis
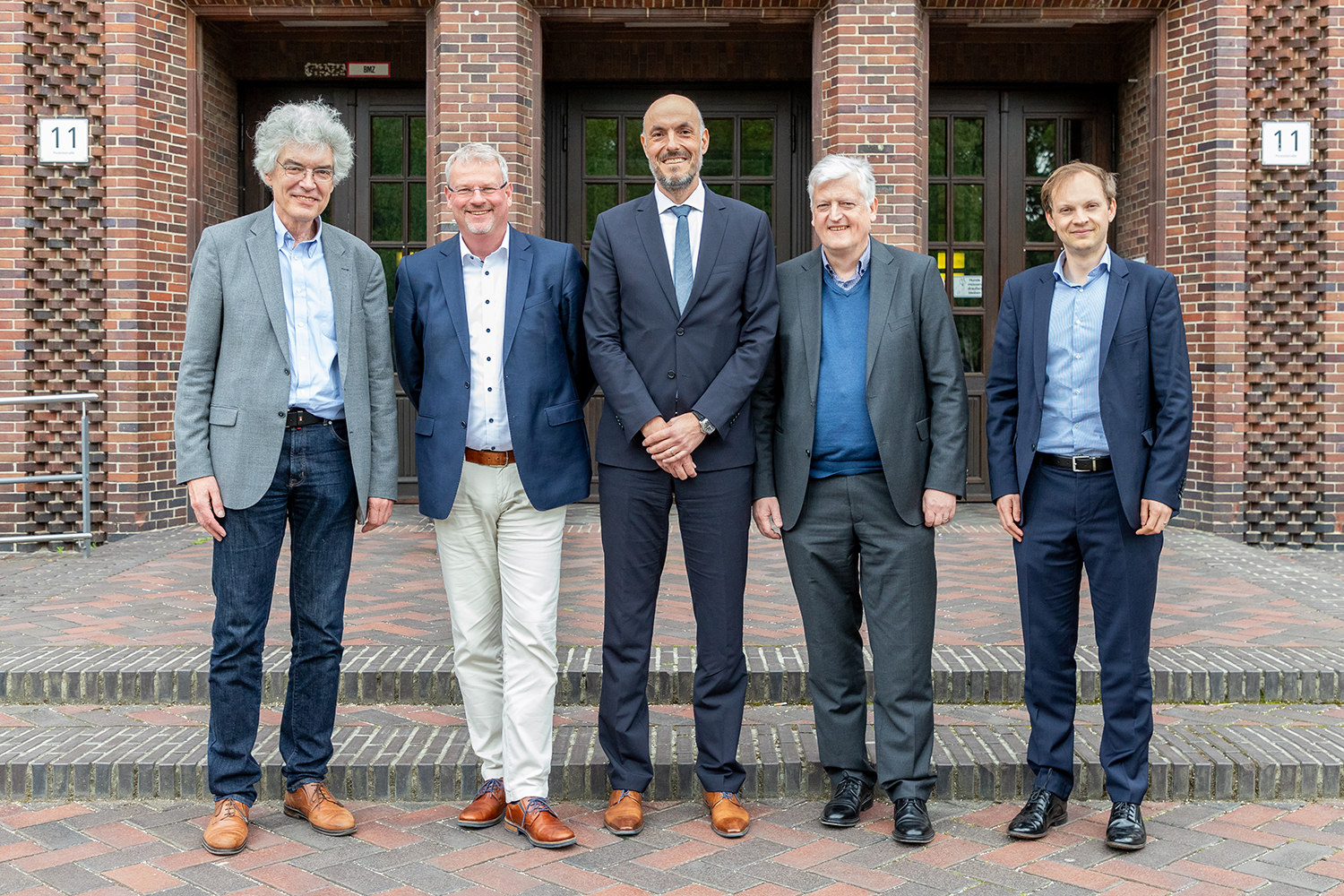
Prof. Dr. Stefan Schulz (Institut für Organische Chemie), Laudator Prof. Dr. Thomas Carell (Leiter des Instituts für Chemische Epigenetik an der Ludwig-Maximilian-Universität München und Inhoffen-Preisträger 2016), Inhoffen-Preisträger Prof. Stephan A. Sieber, Prof. Dr. Thomas Lindel (Geschäftsführender Direktor des Instituts für Organische Chemie), Prof. Christopher Teskey (Institut für Organische Chemie). Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig
Der vom Förderverein des HZI vergebene und mit 8000 Euro dotierte Inhoffen-Preis gilt als die angesehenste deutsche Auszeichnung auf dem Gebiet der Naturstoffchemie. Er wird im Rahmen der Inhoffen-Vorlesung verliehen, einer gemeinsamen Festveranstaltung des HZI, der Technischen Universität Braunschweig und des Fördervereins des HZI. Preisträger*innen der vergangenen Jahre waren Christian Hertweck, Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (2020), Sarah Reisman, California Institute of Technology (2022) und Jörn Piel, ETH Zürich (2023). Federführend bei der Auswahl der Preisträger*innen ist seitens der TU Braunschweig das Institut für Organische Chemie unter Leitung von Prof. Thomas Lindel.
HZI-Promotionspreise

Die Preisträger: Dr. Matthias Bruhn (Promotionspreis), Prof. Stephan A. Sieber (Inhoffen-Medaille), Dr. Blondelle Matio Kemkuignou (Promotionspreis) Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig
Im Rahmen des Festaktes vergab der Förderverein des HZI zudem Promotionspreise an Nachwuchswissenschaftler*innen des HZI. Ausgezeichnet wurden Dr. Blondelle Matio Kemkuignou (HZI) für ihre Arbeit “Novel bioactive natural products from selected Basidiomycota and plant associated Ascomycota” und Dr. Matthias Bruhn (TWINCORE) für seine Promotion “Can B cells see the future?”.
Die Preisträger*innen werden ausgewählt aus Einreichungen aus den HZI-Standorten, dem TWINCORE in Hannover sowie der Technischen Universität Braunschweig. Sie werden jährlich vergeben und beinhalten nur Arbeiten, die im vergangenen Jahr mit der Abschlussprüfung vollendet wurden.
